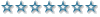Einheitsbeitragssatz -> erheblich höherer Beitrag Ehefrau
Moderatoren: Rossi, Czauderna, Frank
Danke für die Recherche!
Ich werde dann wohl erst einmal einen Widerspruch einlegen. Muss dann wohl entscheiden, ob ich einen Anwalt für ein sozialgerichtliches Verfahren beauftrage, oder ob ich die Kinder zunächst einmal in die Familienversicherung nehme, um bei der PKV zu sparen.
Meine Ehefrau würde ich gerne auch in die PKV nehmen, wurde aber wg. Vorerkrankungen abgelehnt. 70 % Beihlifeanspruch sind leider nur ein unzureichender Schutz.
Ich werde dann wohl erst einmal einen Widerspruch einlegen. Muss dann wohl entscheiden, ob ich einen Anwalt für ein sozialgerichtliches Verfahren beauftrage, oder ob ich die Kinder zunächst einmal in die Familienversicherung nehme, um bei der PKV zu sparen.
Meine Ehefrau würde ich gerne auch in die PKV nehmen, wurde aber wg. Vorerkrankungen abgelehnt. 70 % Beihlifeanspruch sind leider nur ein unzureichender Schutz.
Was mir noch dazu einfällt. Der Spitzenverband Bund macht überhaupt keine Unterschiede wieviel Kinder in der Familie leben. Ganz egal ob es 1 oder 6 Kinder sind. Immer wird 50 % des Ehegatteneinkommens berücksichtigt. Meines Erachtes wird hier die gesamte wirtschaftliche Situation nicht im Einzelfall berücksichtigt; es ist viel zu pauschal!
Ja, das denke ich auch! Solch pauschale Regelungen wurden ja schon vom BSG aufgehoben, leider wird dies sicherlich nicht im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden, und man wird den steinigen (und mit Kostenrisiko verbundenen) gerichtlichen Weg gehen müssen.
Werde erstman am Wochenende Widerspruchsschreiben fertigen!
Nochmals vielen Dank für die Bemnühungen!
Werde erstman am Wochenende Widerspruchsschreiben fertigen!
Nochmals vielen Dank für die Bemnühungen!
Aha, man hat das Problem - die Volksvertreter (Politker) - erkannt.
Es gibt von der CDU/CSU und der SPD einen Änderungsantrag:
Nach dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften soll bei der Berechnung des freiwilligen KVers-Beitrages ein Kinderfreibetrag eingeführt werden.
Dem § 240 wird folgender Absatz 5 angefügt:
"(5) Soweit bei der Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder das Einkommen von Ehegatten oder Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, die nicht einer Krankenkasse nach § 4 Absatz 2 angehören, berücksichtigt wird, ist von diesem Einkommen für jedes gemeinsame unterhaltsberechtigte Kind, für das eine Familienversicherung wegen der Regelung des § 10 Absatz 3 nicht besteht, ein Betrag in Höhe von einem Drittel der monatlichen
Bezugsgröße, für nach § 10 versicherte Kinder ein Betrag in Höhe von einem Fünftel der monatlichen Bezugsgröße abzusetzen."
Will heissen, auch in den Fällen, wo die Kinder familienversichert sind, gibt es dann noch einen Freibetrag in Höhe von 504,00 Euro vom Einkommen des Ehgattens.
Aber was glaubt ihr wohl, was der Spitzbubenverband der Kvén hierzu sagt?
Der lehnt natürlich ab! Der Spibu hat natürlich wieder die Dollarzeichen in den Augen.
http://www.aus-portal.de/aktuell/gesetze/media/Aenderungsantrag_CDU.pdf
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a14/anhoerungen/119/stllg/GKV2.pdf
Meine persönliche Auffassung zu der Stellungnahme; diese Stellungsnahme wurde von hochbezahlten Mitarbeitern des Spibu verzapft, die von dieser beabsichtigten Änderung nicht profitieren.
Sie verdienen ne Menge Kohle und es sind keine Grenzfälle!!!
Manchmal kann der Rossi die Grundzüge des demokratischen Sozialstaates unter Beachtung der solidarischen Prinzipien im Ansatz nicht verstehen!!!
Es gibt von der CDU/CSU und der SPD einen Änderungsantrag:
Nach dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften soll bei der Berechnung des freiwilligen KVers-Beitrages ein Kinderfreibetrag eingeführt werden.
Dem § 240 wird folgender Absatz 5 angefügt:
"(5) Soweit bei der Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder das Einkommen von Ehegatten oder Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, die nicht einer Krankenkasse nach § 4 Absatz 2 angehören, berücksichtigt wird, ist von diesem Einkommen für jedes gemeinsame unterhaltsberechtigte Kind, für das eine Familienversicherung wegen der Regelung des § 10 Absatz 3 nicht besteht, ein Betrag in Höhe von einem Drittel der monatlichen
Bezugsgröße, für nach § 10 versicherte Kinder ein Betrag in Höhe von einem Fünftel der monatlichen Bezugsgröße abzusetzen."
Will heissen, auch in den Fällen, wo die Kinder familienversichert sind, gibt es dann noch einen Freibetrag in Höhe von 504,00 Euro vom Einkommen des Ehgattens.
Aber was glaubt ihr wohl, was der Spitzbubenverband der Kvén hierzu sagt?
Der lehnt natürlich ab! Der Spibu hat natürlich wieder die Dollarzeichen in den Augen.
http://www.aus-portal.de/aktuell/gesetze/media/Aenderungsantrag_CDU.pdf
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a14/anhoerungen/119/stllg/GKV2.pdf
Meine persönliche Auffassung zu der Stellungnahme; diese Stellungsnahme wurde von hochbezahlten Mitarbeitern des Spibu verzapft, die von dieser beabsichtigten Änderung nicht profitieren.
Sie verdienen ne Menge Kohle und es sind keine Grenzfälle!!!
Manchmal kann der Rossi die Grundzüge des demokratischen Sozialstaates unter Beachtung der solidarischen Prinzipien im Ansatz nicht verstehen!!!
-
Beamter2007
- Postrank2

- Beiträge: 13
- Registriert: 29.05.2009, 08:38
Vielen Dank Rossi. Es scheint, als erhielten wir Schützenhilfe vom Gesetzgeber. Man kann nur hoffen, dass der Änderungsvorschlag Gesetz wird. Unglücklicherweise hat der GKV-Spitzenverband die Rechtsprechung des BSG auf seiner Seite. Das BSG hat 1993 entschieden, dass für familienversicherte Kinder nicht zwingend ein Abzug für Unterhaltsaufwendungen in Betracht kommt.
Meines Erachtens verkennt das BSG aber die familienschädliche Wirkung der Regelung, mit der bei steigender Kinderzahl die effektive Beitragsbelastung des freiwilligen Mitglieds steigt. Eine Frau ohne Kinder zahlt den gleichen Beitrag wie eine Frau mit 10 Kindern. Ist das gerecht? In meinem Fall muss meine Frau etwa die Hälfte ihres fiktiven (!) Ehegattenunterhalts für den KV-Beitrag aufwenden; eine Frau ohne Kinder müsste bei einem entsprechenden fiktiven Ehegatteneinkommen nur ein Zehntel ihres fiktiven Ehegatteneinkommens für GKV-Beiträge aufwenden. Eine solche familienschädliche Regelung hat der Große Senat des BSG 1985 für verfassungswidrig befunden. Die kostenlose Mitversicherung der Kinder ändert an der quotal steigenden Belastung der Ehefrau nichts. Daher ist meines Erachtens die Gesetzesinitiative berechtigt, um dem derzeitigen verfassungswidrigen Zustand (Verstoß gg. Art. 6 GG) entgegenzuwirken.
Ich hoffe, ich bekomme wenigstens vor dem Sozialgericht Recht. Ein Verfahren vor den höheren Gerichten kann ich mir nicht leisten, ich müsste auf entsprechende Versäumnisurteile hoffen.
Meines Erachtens verkennt das BSG aber die familienschädliche Wirkung der Regelung, mit der bei steigender Kinderzahl die effektive Beitragsbelastung des freiwilligen Mitglieds steigt. Eine Frau ohne Kinder zahlt den gleichen Beitrag wie eine Frau mit 10 Kindern. Ist das gerecht? In meinem Fall muss meine Frau etwa die Hälfte ihres fiktiven (!) Ehegattenunterhalts für den KV-Beitrag aufwenden; eine Frau ohne Kinder müsste bei einem entsprechenden fiktiven Ehegatteneinkommen nur ein Zehntel ihres fiktiven Ehegatteneinkommens für GKV-Beiträge aufwenden. Eine solche familienschädliche Regelung hat der Große Senat des BSG 1985 für verfassungswidrig befunden. Die kostenlose Mitversicherung der Kinder ändert an der quotal steigenden Belastung der Ehefrau nichts. Daher ist meines Erachtens die Gesetzesinitiative berechtigt, um dem derzeitigen verfassungswidrigen Zustand (Verstoß gg. Art. 6 GG) entgegenzuwirken.
Ich hoffe, ich bekomme wenigstens vor dem Sozialgericht Recht. Ein Verfahren vor den höheren Gerichten kann ich mir nicht leisten, ich müsste auf entsprechende Versäumnisurteile hoffen.
-
Beamter2007
- Postrank2

- Beiträge: 13
- Registriert: 29.05.2009, 08:38
-
Beamter2007
- Postrank2

- Beiträge: 13
- Registriert: 29.05.2009, 08:38
Abs. ...
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Platz der Republik 1
11011 Berlin
gesundheitsausschuss@bundestag.de
..., den 8.6.2009
Stellungnahme eines Betroffenen zu den Änderungsanträgen der Fraktionen von CDU/CSU und SPD sowie der Fraktion DIE LINKE zum Regierungsentwurf einer 15. AMG-Novelle (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften)
[Ausschussdrucksachen 16(14)0527 sowie 16(14)523(1) und (2)]
Hier: Änderungsantrag 13 - Drs.16/12256 - Zu Artikel 15 Nummer 10b - neu - (Kinderfreibeträge/beitragsrechtliche Behandlung von weitergereichtem Pflegegeld)
Sehr geehrte Damen und Herren,
den o.g. Änderungsantrag kann ich nur begrüßen.
1. Beitragsregelung des GKV Spitzenverbandes für freiwillige Mitglieder erheblich familienschädlich
Der GKV-Spitzenverband hat von der bisherigen Satzungsermächtigung nicht sachgerecht Gebrauch gemacht. Vielmehr hat er die einheitliche Regelung der Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder dazu missbraucht, die Bemessungsgrundlage bei der Zurechnung von Ehegatteneinkommen erheblich zu verbreitern. Das hat insbesondere bei Beamtenfamilien mit mehreren Kindern zu Beitragserhöhungen auf mehr als das 2-fache des bisherigen Beitrages geführt. Dementsprechend haben sich im Internet bereits Foren betroffener Mitglieder gebildet.
http://www.forum-krankenversicherung.de ... c&start=15
http://www.forum-krankenversicherung.de ... php?t=2105
Die Beitragserhöhung des GKV-Spitzenverbandes ist erheblich familienschädlich. Die familienschädliche Wirkung steigt mit der Kinderzahl. Diese Regelung ist daher auch nicht mit den Richtlinien der Politik der Bundesregierung vereinbar. Darüber hinaus bestehen Zweifel, ob die Regelung mit Art. 6 und Art. 3 GG vereinbar ist.
Die Regelung des GKV-Spitzenverbandes führt daszu, dass ein kinderloses freiwilliges Mitglied ohne Einkommen den gleichen Beitrag bezahlt, wie ein freiwilliges Mitglied ohne Einkommen mit 10 Kindern. In meinem Fall muss meine Frau, ohne Einkommen, mit vier Kindern etwa die Hälfte ihres fiktiven (!) Ehegattenunterhalts für den KV-Beitrag aufwenden; eine Frau ohne Kinder müsste bei einem entsprechenden fiktiven Ehegatteneinkommen nur ein Zehntel ihres fiktiven Ehegatteneinkommens für GKV-Beiträge aufwenden. Eine solche familienschädliche Regelung hat der Große Senat des BSG 1985 für verfassungswidrig befunden. Die kostenlose Mitversicherung der Kinder ändert an der quotal steigenden Belastung der Ehefrau nichts. Daher ist die Gesetzesinitiative meines Erachtens berechtigt und auch erforderlich.
2. Erweiterung der geplanten Neuregelung auf Stiefkinder
Ich rege an, den Gesetzesvorschlag um eine Regelung zu erweitern, die nicht nur auf gemeinsame unterhaltsberechtigte Kinder abstellt, sondern auch Stiefkinder erfasst, sofern sie von dem Ehegatten, dessen Einkommen dem freiwilligen Mitglied zugerechnet wird, in seinen Haushalt aufgenommen worden sind (gesetzestechnisch durch einen Verweis auf § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG, vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegatten). Obwohl ein Stiefvater seinen Stiefkindern gegenüber rechtlich nicht zum Unterhalt verpflichtet ist, ist er faktisch unterhaltsverpflichtet. Derartige Patchwork-Familien bilden sozialrechtlich eine Bedarfsgemeinschaft. Dementsprechend wird das Einkommen des Stiefvaters z.B. auch bei Anträgen auf Lernmittelbefreiung und sonstige Sozialleistungen für die Stiefkinder berücksichtigt, was zur Folge hat, dass solche Leistungen nicht gewährt werden können. Der Gesetzgeber erlegt damit faktisch dem Stiefvater die Kosten hierfür auf.
Im deutschen Recht sind daher bei Sozialleistungen Stiefkinder, die im Haushalt des Stiefvaters leben, leiblichen Kindern gleichgestellt. Denn die Kosten für den Stiefvater und den leiblichen Vater, der mit seinen Kindern einen Haushalt teilt, unterscheiden sich nicht. Das gilt insbesondere, wenn die Ehefrau nicht berufstätig ist. Schließlich würde auch eine Adoption, die zu einer rechtlichen Gleichstellung der Kinder mit leiblichen Kindern führen würde, die wirtschaftliche Belastung durch die Kinder weder verstärken, noch verringern. Rein nach diesem formalen Kriterium darf also nicht differenziert werden. Auf diesem Grundsatz basieren z.B. § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG für das Kindergeld sowie die Beamtengesetze (Familienzuschläge für Stiefkinder) und Beihilfeverordnungen (Beihilfe für Stiefkinder) der Länder durch ihre Verweise auf § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Denn die Kosten für Lebensmittel, Wohnraumeinrichtung, Miete, Telefon, Internet, Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Kleidung, Schulbücher, Freizeiten, Taschengeld, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, Kosmetika, Rundfunkgebühren, Sportvereine, Schulbustickets, Fahrschule, Urlaub, Klassenfahrten, Musikunterricht, Versicherungen usw. fallen in der Einverdienerehe zwangsläufig dem Stiefvater zur Last. Wenn ein Kind etwas aus dem Kühlschrank nimmt, das Licht anschaltet, telefoniert usw. muss hierfür der alleinverdienende Stiefvater aufkommen. Faktisch besteht also eine Unterhaltspflicht auch beim Stiefvater, wenn die Kinder im gemeinsamen Haushalt wohnen. Eine Trennung ist nicht möglich und würde einer intakten Familie auch entgegenstehen. Nach Art. 6 GG ist eine solche Trennung auch nicht erwünscht.
3. Bisherige Regelung des GKV-Spitzenverbandes berücksichtigt nicht die Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitgliedes, sondern die des Ehegatten
Der GKV-Spitzenverband hat gem. § 240 SGB V die Ermächtigung, die Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder einheitlich zu regeln. Dabei ist „sicherzustellen, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitglieds berücksichtigt.“ (§ 240 Abs. 1 Satz 2 SGB V).
Bei der Zurechnung von Ehegatteneinkommen beim freiwilligen Mitglied ist nach der Rechtsprechung des Großen Senats des Bundessozialgerichts entscheidend, welcher Teil des Ehegatteneinkommens „netto“ (d.H. nach Abzug weiterer Unterhaltsverpflichtungen) für den Unterhalt des freiwilligen Mitglieds zur Verfügung steht. Das „Bruttoprinzip“ (Abzugsverbot von Unterhaltsverpflichtungen von eigenen Einkünften des Mitglieds, jetzt § 240 Abs. 2 Satz 2 SGB V) gilt nur hinsichtlich der eigenen Einkünfte des Mitglieds. Der Große Senat des BSG führte hierzu wörtlich aus:
„Der Hinweis der Beklagten, auch bei eigenen Einkünften des freiwillig Versicherten würde der Grundlohn nach dem Brutto-Prinzip ohne vorherigen Abzug der Unterhaltsansprüche von Familienangehörigen berechnet, verkennt, daß es hier nicht um Einkünfte iS des § 180 Abs 4 Satz 1 RVO geht, sondern um einen erst aus den Einkünften eines Dritten - des Ehegatten - abgeleiteten Maßstab für einen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des freiwillig Versicherten entsprechenden Grundlohn. Es handelt sich bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für anderweitig Unterhaltsberechtigte also nicht um Absetzungen von den Brutto-Einkünften des freiwillig Versicherten, sondern von denen des verdienenden Ehegatten. Erst danach steht der Wert der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Versicherten fest, der seinerseits allerdings - aber erst jetzt - dem Brutto-Prinzip unterfällt. Im übrigen bewirkt dieses Verfahren eine erwünschte Gleichbehandlung des freiwillig versicherten Ehegatten in der intakten Ehe mit dem freiwillig versicherten geschiedenen Ehegatten; denn dessen Unterhaltsrente wird ebenfalls nur unter Berücksichtigung eines Aufwandes des unterhaltspflichtigen Ehegatten für andere Unterhaltsberechtigte (zB Kinder) ermittelt und ist nur in dieser Höhe (insoweit also ‚netto’) der Beitragsmaßstab nach § 180 Abs 4 Satz 1 RVO.“
BSG, Großer Senat, Beschluss vom 24.6.1985, GS 1/84, bei juris Rn. 64 ff.
Der Anteil des Ehegatteneinkommens, der für den Unterhalt des freiwilligen Mitglieds zur Verfügung steht, wird umso geringer, je mehr Kinder vom verdienenden Ehegatten unterhalten werden. Durch das Prinzip des „halben Bruttolohnes“, das der GKV Spitzenverband in seiner Satzung anwendet, steigt also die Benachteiligung von Familien mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl.
Rechenbeispiel:
Der Beitrag einer freiwillig versicherten Hausfrau ohne Kinder, deren Ehemann 40.000 € verdient, würde sich nach der Satzung des GKV aus der Hälfte von 40.000 € bemessen. Der Beitrag einer Ehefrau mit 4 Kindern bemisst sich ebenfalls nach der Hälfte des Ehegatteneinkommens. Dem kinderlosen Mitglied steht ein rechnerischer Unterhalt von 20.000 € zur Verfügung. Der Mutter von vier Kindern steht lediglich ein rechnerischer Unterhalt von 6.667 € zur Verfügung (1/6 des Bruttolohnes). Bei dem monatlichen Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung von 309,62 € muss die Mutter rund 55,7 % des ihr zur Verfügung stehenden Unterhalts für ihre freiwillige Krankenversicherung aufwenden (309,62 € * 12 Monate *100 / 6667 €). Die kinderlose Ehefrau muss hingegen lediglich 18,6 % des ihr zuzurechnenden Unterhalts für ihre Krankenversicherung aufwenden (309,62 € * 12 Monate * 100 / 20.000 €). Das freiwillige Mitglied ohne Einkommen mit Kindern wird also dreimal so stark belastet, wie das kinderlose Mitglied ohne Einkommen. Es liegt auf der Hand, dass hier wesentlich ungleiche Sachverhalte verliegen. Nach Art. 3 Abs. 1 GG dürfen wesentlich ungleiche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden. Bei einem Einkommen von 40.000 € und 9 Kindern müsste ein freiwilliges Mitglied nach der Satzung des GKV-Spitzenerbandes bereits seinen gesamten rechnerischen Unterhalt für Versicherungsbeiträge aufwenden. Gegenüber kinderlosen Familien liegt also eine steigende Benachteiligung von Familien mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl vor, die sich in hohem Maße familienschädlich auswirkt und damit Art. 6 GG und Art. 3 GG verletzt. Eine solche Benachteiligung hat der Große Senat des Bundessozialgerichts für verfassungswidrig erklärt:
„Die Kasse verletzt ihr Regelungsermessen …, wenn sie die aus dem Einkommen des Ehegatten ableitbare wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Versicherten gänzlich ohne Berücksichtigung anderweitiger Belastungen dieses Familieneinkommens bestimmt. Dies gilt insbesondere für den Aufwand des Unterhalts gemeinsamer Kinder. Es liegt zB auf der Hand, daß die Bestimmung des halben Brutto-Einkommens des verdienenden Ehegatten als Grundlohn für den freiwillig versicherten, nicht verdienenden Ehegatten die verbleibende Einkommenshälfte als rechnerischen Basiswert für die Finanzierung der Krankenversicherungen der übrigen Familienmitglieder um so stärker entwertet, je mehr Kinder vorhanden sind. … Bedeutet … das Prinzip des ‚halben Bruttolohnes’ eine steigende Benachteiligung von Familien mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl, enthält es eine in hohem Maße familienschädliche Wirkung; der GS ist der Auffassung, dass eine solche Handhabung des Ermessensrechts aus § 180 Abs. 4 Satz 3 RVO das besonders für sozialrechtliche Gestaltungen empfindliche Gebot aus Art. 6 GG verletzt, Ehe und Familie zu schützen … Es verstößt nämlich gegen dieses Gebot, wenn wirtschaftliche Nachteile gerade an das Bestehen einer Familie geknüpft sind (BVerfGE 28, 104, 112; 28, 324, 347; 48, 346, 366).
Hinzu kommt eine beträchtlich benachteiligende Behandlung familiärer Sachverhalte der in Rede stehenden Art gegenüber vergleichbaren Sachverhalten bei anderen freiwillig Versicherten. …
Nach Auffassung des GS führt jedenfalls allein der Umstand, daß der freiwillig Versicherte in oder aus einer gescheiterten Ehe günstiger behandelt wird als der freiwillig Versicherte in der intakten Ehe und daraus folgend auch die Belastung durch den Aufwand für unterhaltsberechtigte Kinder entsprechend verringert ist, zu einer nicht mehr sachgerechten (vgl dazu Maunz-Dürig ua, aaO, RdNrn 310 ff zu Art 3) Ungleichbehandlung iS des Art 3 GG. Gerade im Bereich der Ermessensausübung hat aber der Gleichheitssatz eine besondere Bedeutung (vgl Maunz-Dürig ua, aaO, RdNrn 426 ff zu Art 3).“
BSG, Großer Senat, Beschluss vom 24.6.1985, GS 1/84, bei juris Rn. 64 ff.
Dabei hatte der Große Senat allein den Fall zu entscheiden, dass unterhaltsberechtigte gemeinsame Kinder nicht kostenfrei mitversichert waren. Daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass alle anderen Fälle rechtmäßig sind. Es liegt vielmehr im Wesen der Rspr., dass nur der Anlassfall entschieden werden und keine allgemeingültige Entscheidung getroffen werden kann, die alle Konstellationen abdeckt. Die zuvor zitierte steigende Benachteiligung von Familie mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl liegt auch im Fall der Satzung des GKV-Spitzenverbandes vor. Anders als vom GKV-Spitzenverband behauptet (S. 23 – zu § 2 Abs. 4, 4. Unterabsatz der Begründung), reicht die kostenfreie Mitversicherung von Kindern gerade nicht, den mit steigender Kinderzahl verringerten rechnerischen Ehegattenunterhalt zu kompensieren. Denn wie bereits dargelegt steht bereits bei 4 Kindern nur noch ein Drittel des hälftigen Ehegatteneinkommens tatsächlich als Unterhalt für das Mitglied zur Verfügung. Durch die kostenfreie Mitversicherung wird hieran nichts geändert.
Es ist – entgegen der Auffassung des GKV - nicht Aufgabe des Gesetzgebers diese Benachteiligung freiwilliger Mitglieder mit Kindern dadurch auszugleichen, dass der Steuerzahler für den Ausgleich aufkommt. Die freiwilligen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung bilden eine Gemeinschaft. Es ist Aufgabe des GKV-Spitzenverbandes, eine Regelung zu schaffen, die die gemeinsamen Kosten aller freiwillig Versicherten gerecht nach der Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder (nicht deren Ehegatten!) verteilt.
Bisher haben die Krankenkassen, wie etwa die ..., diese Grundsätze der gleichmäßigen Beitragserhebung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in ihrer Satzung ordnungsgemäß beachtet. Für jedes unterhaltsberechtigte Kind wurde 1/3 der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV vom Ehegatteneinkommen (bereinigt um Werbungskosten/Betriebsausgaben) vor hälftiger Zurechnung an das Mitglied abgesetzt. Vergleichbare Regelungen enthielten auch die anderen GKV-Kassensatzungen. Der GKV-Spitzenverband wollte durch seine Neuregelung eine einheitliche Beitragsfestsetzung errechen, aber dabei die Bemessungsgrundlagen nicht verbreitern (Begründung der Satzung, A. Allgemeiner Teil, Absatz 4).
Ich bitte Sie darum, meine Stellungnahme bei den Beratungen über die geplante Gesetzesänderung zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
...
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Platz der Republik 1
11011 Berlin
gesundheitsausschuss@bundestag.de
..., den 8.6.2009
Stellungnahme eines Betroffenen zu den Änderungsanträgen der Fraktionen von CDU/CSU und SPD sowie der Fraktion DIE LINKE zum Regierungsentwurf einer 15. AMG-Novelle (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften)
[Ausschussdrucksachen 16(14)0527 sowie 16(14)523(1) und (2)]
Hier: Änderungsantrag 13 - Drs.16/12256 - Zu Artikel 15 Nummer 10b - neu - (Kinderfreibeträge/beitragsrechtliche Behandlung von weitergereichtem Pflegegeld)
Sehr geehrte Damen und Herren,
den o.g. Änderungsantrag kann ich nur begrüßen.
1. Beitragsregelung des GKV Spitzenverbandes für freiwillige Mitglieder erheblich familienschädlich
Der GKV-Spitzenverband hat von der bisherigen Satzungsermächtigung nicht sachgerecht Gebrauch gemacht. Vielmehr hat er die einheitliche Regelung der Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder dazu missbraucht, die Bemessungsgrundlage bei der Zurechnung von Ehegatteneinkommen erheblich zu verbreitern. Das hat insbesondere bei Beamtenfamilien mit mehreren Kindern zu Beitragserhöhungen auf mehr als das 2-fache des bisherigen Beitrages geführt. Dementsprechend haben sich im Internet bereits Foren betroffener Mitglieder gebildet.
http://www.forum-krankenversicherung.de ... c&start=15
http://www.forum-krankenversicherung.de ... php?t=2105
Die Beitragserhöhung des GKV-Spitzenverbandes ist erheblich familienschädlich. Die familienschädliche Wirkung steigt mit der Kinderzahl. Diese Regelung ist daher auch nicht mit den Richtlinien der Politik der Bundesregierung vereinbar. Darüber hinaus bestehen Zweifel, ob die Regelung mit Art. 6 und Art. 3 GG vereinbar ist.
Die Regelung des GKV-Spitzenverbandes führt daszu, dass ein kinderloses freiwilliges Mitglied ohne Einkommen den gleichen Beitrag bezahlt, wie ein freiwilliges Mitglied ohne Einkommen mit 10 Kindern. In meinem Fall muss meine Frau, ohne Einkommen, mit vier Kindern etwa die Hälfte ihres fiktiven (!) Ehegattenunterhalts für den KV-Beitrag aufwenden; eine Frau ohne Kinder müsste bei einem entsprechenden fiktiven Ehegatteneinkommen nur ein Zehntel ihres fiktiven Ehegatteneinkommens für GKV-Beiträge aufwenden. Eine solche familienschädliche Regelung hat der Große Senat des BSG 1985 für verfassungswidrig befunden. Die kostenlose Mitversicherung der Kinder ändert an der quotal steigenden Belastung der Ehefrau nichts. Daher ist die Gesetzesinitiative meines Erachtens berechtigt und auch erforderlich.
2. Erweiterung der geplanten Neuregelung auf Stiefkinder
Ich rege an, den Gesetzesvorschlag um eine Regelung zu erweitern, die nicht nur auf gemeinsame unterhaltsberechtigte Kinder abstellt, sondern auch Stiefkinder erfasst, sofern sie von dem Ehegatten, dessen Einkommen dem freiwilligen Mitglied zugerechnet wird, in seinen Haushalt aufgenommen worden sind (gesetzestechnisch durch einen Verweis auf § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG, vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegatten). Obwohl ein Stiefvater seinen Stiefkindern gegenüber rechtlich nicht zum Unterhalt verpflichtet ist, ist er faktisch unterhaltsverpflichtet. Derartige Patchwork-Familien bilden sozialrechtlich eine Bedarfsgemeinschaft. Dementsprechend wird das Einkommen des Stiefvaters z.B. auch bei Anträgen auf Lernmittelbefreiung und sonstige Sozialleistungen für die Stiefkinder berücksichtigt, was zur Folge hat, dass solche Leistungen nicht gewährt werden können. Der Gesetzgeber erlegt damit faktisch dem Stiefvater die Kosten hierfür auf.
Im deutschen Recht sind daher bei Sozialleistungen Stiefkinder, die im Haushalt des Stiefvaters leben, leiblichen Kindern gleichgestellt. Denn die Kosten für den Stiefvater und den leiblichen Vater, der mit seinen Kindern einen Haushalt teilt, unterscheiden sich nicht. Das gilt insbesondere, wenn die Ehefrau nicht berufstätig ist. Schließlich würde auch eine Adoption, die zu einer rechtlichen Gleichstellung der Kinder mit leiblichen Kindern führen würde, die wirtschaftliche Belastung durch die Kinder weder verstärken, noch verringern. Rein nach diesem formalen Kriterium darf also nicht differenziert werden. Auf diesem Grundsatz basieren z.B. § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG für das Kindergeld sowie die Beamtengesetze (Familienzuschläge für Stiefkinder) und Beihilfeverordnungen (Beihilfe für Stiefkinder) der Länder durch ihre Verweise auf § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Denn die Kosten für Lebensmittel, Wohnraumeinrichtung, Miete, Telefon, Internet, Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Kleidung, Schulbücher, Freizeiten, Taschengeld, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, Kosmetika, Rundfunkgebühren, Sportvereine, Schulbustickets, Fahrschule, Urlaub, Klassenfahrten, Musikunterricht, Versicherungen usw. fallen in der Einverdienerehe zwangsläufig dem Stiefvater zur Last. Wenn ein Kind etwas aus dem Kühlschrank nimmt, das Licht anschaltet, telefoniert usw. muss hierfür der alleinverdienende Stiefvater aufkommen. Faktisch besteht also eine Unterhaltspflicht auch beim Stiefvater, wenn die Kinder im gemeinsamen Haushalt wohnen. Eine Trennung ist nicht möglich und würde einer intakten Familie auch entgegenstehen. Nach Art. 6 GG ist eine solche Trennung auch nicht erwünscht.
3. Bisherige Regelung des GKV-Spitzenverbandes berücksichtigt nicht die Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitgliedes, sondern die des Ehegatten
Der GKV-Spitzenverband hat gem. § 240 SGB V die Ermächtigung, die Beitragsbemessung für freiwillige Mitglieder einheitlich zu regeln. Dabei ist „sicherzustellen, dass die Beitragsbelastung die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des freiwilligen Mitglieds berücksichtigt.“ (§ 240 Abs. 1 Satz 2 SGB V).
Bei der Zurechnung von Ehegatteneinkommen beim freiwilligen Mitglied ist nach der Rechtsprechung des Großen Senats des Bundessozialgerichts entscheidend, welcher Teil des Ehegatteneinkommens „netto“ (d.H. nach Abzug weiterer Unterhaltsverpflichtungen) für den Unterhalt des freiwilligen Mitglieds zur Verfügung steht. Das „Bruttoprinzip“ (Abzugsverbot von Unterhaltsverpflichtungen von eigenen Einkünften des Mitglieds, jetzt § 240 Abs. 2 Satz 2 SGB V) gilt nur hinsichtlich der eigenen Einkünfte des Mitglieds. Der Große Senat des BSG führte hierzu wörtlich aus:
„Der Hinweis der Beklagten, auch bei eigenen Einkünften des freiwillig Versicherten würde der Grundlohn nach dem Brutto-Prinzip ohne vorherigen Abzug der Unterhaltsansprüche von Familienangehörigen berechnet, verkennt, daß es hier nicht um Einkünfte iS des § 180 Abs 4 Satz 1 RVO geht, sondern um einen erst aus den Einkünften eines Dritten - des Ehegatten - abgeleiteten Maßstab für einen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des freiwillig Versicherten entsprechenden Grundlohn. Es handelt sich bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für anderweitig Unterhaltsberechtigte also nicht um Absetzungen von den Brutto-Einkünften des freiwillig Versicherten, sondern von denen des verdienenden Ehegatten. Erst danach steht der Wert der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Versicherten fest, der seinerseits allerdings - aber erst jetzt - dem Brutto-Prinzip unterfällt. Im übrigen bewirkt dieses Verfahren eine erwünschte Gleichbehandlung des freiwillig versicherten Ehegatten in der intakten Ehe mit dem freiwillig versicherten geschiedenen Ehegatten; denn dessen Unterhaltsrente wird ebenfalls nur unter Berücksichtigung eines Aufwandes des unterhaltspflichtigen Ehegatten für andere Unterhaltsberechtigte (zB Kinder) ermittelt und ist nur in dieser Höhe (insoweit also ‚netto’) der Beitragsmaßstab nach § 180 Abs 4 Satz 1 RVO.“
BSG, Großer Senat, Beschluss vom 24.6.1985, GS 1/84, bei juris Rn. 64 ff.
Der Anteil des Ehegatteneinkommens, der für den Unterhalt des freiwilligen Mitglieds zur Verfügung steht, wird umso geringer, je mehr Kinder vom verdienenden Ehegatten unterhalten werden. Durch das Prinzip des „halben Bruttolohnes“, das der GKV Spitzenverband in seiner Satzung anwendet, steigt also die Benachteiligung von Familien mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl.
Rechenbeispiel:
Der Beitrag einer freiwillig versicherten Hausfrau ohne Kinder, deren Ehemann 40.000 € verdient, würde sich nach der Satzung des GKV aus der Hälfte von 40.000 € bemessen. Der Beitrag einer Ehefrau mit 4 Kindern bemisst sich ebenfalls nach der Hälfte des Ehegatteneinkommens. Dem kinderlosen Mitglied steht ein rechnerischer Unterhalt von 20.000 € zur Verfügung. Der Mutter von vier Kindern steht lediglich ein rechnerischer Unterhalt von 6.667 € zur Verfügung (1/6 des Bruttolohnes). Bei dem monatlichen Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung von 309,62 € muss die Mutter rund 55,7 % des ihr zur Verfügung stehenden Unterhalts für ihre freiwillige Krankenversicherung aufwenden (309,62 € * 12 Monate *100 / 6667 €). Die kinderlose Ehefrau muss hingegen lediglich 18,6 % des ihr zuzurechnenden Unterhalts für ihre Krankenversicherung aufwenden (309,62 € * 12 Monate * 100 / 20.000 €). Das freiwillige Mitglied ohne Einkommen mit Kindern wird also dreimal so stark belastet, wie das kinderlose Mitglied ohne Einkommen. Es liegt auf der Hand, dass hier wesentlich ungleiche Sachverhalte verliegen. Nach Art. 3 Abs. 1 GG dürfen wesentlich ungleiche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden. Bei einem Einkommen von 40.000 € und 9 Kindern müsste ein freiwilliges Mitglied nach der Satzung des GKV-Spitzenerbandes bereits seinen gesamten rechnerischen Unterhalt für Versicherungsbeiträge aufwenden. Gegenüber kinderlosen Familien liegt also eine steigende Benachteiligung von Familien mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl vor, die sich in hohem Maße familienschädlich auswirkt und damit Art. 6 GG und Art. 3 GG verletzt. Eine solche Benachteiligung hat der Große Senat des Bundessozialgerichts für verfassungswidrig erklärt:
„Die Kasse verletzt ihr Regelungsermessen …, wenn sie die aus dem Einkommen des Ehegatten ableitbare wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Versicherten gänzlich ohne Berücksichtigung anderweitiger Belastungen dieses Familieneinkommens bestimmt. Dies gilt insbesondere für den Aufwand des Unterhalts gemeinsamer Kinder. Es liegt zB auf der Hand, daß die Bestimmung des halben Brutto-Einkommens des verdienenden Ehegatten als Grundlohn für den freiwillig versicherten, nicht verdienenden Ehegatten die verbleibende Einkommenshälfte als rechnerischen Basiswert für die Finanzierung der Krankenversicherungen der übrigen Familienmitglieder um so stärker entwertet, je mehr Kinder vorhanden sind. … Bedeutet … das Prinzip des ‚halben Bruttolohnes’ eine steigende Benachteiligung von Familien mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl, enthält es eine in hohem Maße familienschädliche Wirkung; der GS ist der Auffassung, dass eine solche Handhabung des Ermessensrechts aus § 180 Abs. 4 Satz 3 RVO das besonders für sozialrechtliche Gestaltungen empfindliche Gebot aus Art. 6 GG verletzt, Ehe und Familie zu schützen … Es verstößt nämlich gegen dieses Gebot, wenn wirtschaftliche Nachteile gerade an das Bestehen einer Familie geknüpft sind (BVerfGE 28, 104, 112; 28, 324, 347; 48, 346, 366).
Hinzu kommt eine beträchtlich benachteiligende Behandlung familiärer Sachverhalte der in Rede stehenden Art gegenüber vergleichbaren Sachverhalten bei anderen freiwillig Versicherten. …
Nach Auffassung des GS führt jedenfalls allein der Umstand, daß der freiwillig Versicherte in oder aus einer gescheiterten Ehe günstiger behandelt wird als der freiwillig Versicherte in der intakten Ehe und daraus folgend auch die Belastung durch den Aufwand für unterhaltsberechtigte Kinder entsprechend verringert ist, zu einer nicht mehr sachgerechten (vgl dazu Maunz-Dürig ua, aaO, RdNrn 310 ff zu Art 3) Ungleichbehandlung iS des Art 3 GG. Gerade im Bereich der Ermessensausübung hat aber der Gleichheitssatz eine besondere Bedeutung (vgl Maunz-Dürig ua, aaO, RdNrn 426 ff zu Art 3).“
BSG, Großer Senat, Beschluss vom 24.6.1985, GS 1/84, bei juris Rn. 64 ff.
Dabei hatte der Große Senat allein den Fall zu entscheiden, dass unterhaltsberechtigte gemeinsame Kinder nicht kostenfrei mitversichert waren. Daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass alle anderen Fälle rechtmäßig sind. Es liegt vielmehr im Wesen der Rspr., dass nur der Anlassfall entschieden werden und keine allgemeingültige Entscheidung getroffen werden kann, die alle Konstellationen abdeckt. Die zuvor zitierte steigende Benachteiligung von Familie mit Kindern im Verhältnis zur Kinderzahl liegt auch im Fall der Satzung des GKV-Spitzenverbandes vor. Anders als vom GKV-Spitzenverband behauptet (S. 23 – zu § 2 Abs. 4, 4. Unterabsatz der Begründung), reicht die kostenfreie Mitversicherung von Kindern gerade nicht, den mit steigender Kinderzahl verringerten rechnerischen Ehegattenunterhalt zu kompensieren. Denn wie bereits dargelegt steht bereits bei 4 Kindern nur noch ein Drittel des hälftigen Ehegatteneinkommens tatsächlich als Unterhalt für das Mitglied zur Verfügung. Durch die kostenfreie Mitversicherung wird hieran nichts geändert.
Es ist – entgegen der Auffassung des GKV - nicht Aufgabe des Gesetzgebers diese Benachteiligung freiwilliger Mitglieder mit Kindern dadurch auszugleichen, dass der Steuerzahler für den Ausgleich aufkommt. Die freiwilligen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung bilden eine Gemeinschaft. Es ist Aufgabe des GKV-Spitzenverbandes, eine Regelung zu schaffen, die die gemeinsamen Kosten aller freiwillig Versicherten gerecht nach der Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder (nicht deren Ehegatten!) verteilt.
Bisher haben die Krankenkassen, wie etwa die ..., diese Grundsätze der gleichmäßigen Beitragserhebung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in ihrer Satzung ordnungsgemäß beachtet. Für jedes unterhaltsberechtigte Kind wurde 1/3 der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV vom Ehegatteneinkommen (bereinigt um Werbungskosten/Betriebsausgaben) vor hälftiger Zurechnung an das Mitglied abgesetzt. Vergleichbare Regelungen enthielten auch die anderen GKV-Kassensatzungen. Der GKV-Spitzenverband wollte durch seine Neuregelung eine einheitliche Beitragsfestsetzung errechen, aber dabei die Bemessungsgrundlagen nicht verbreitern (Begründung der Satzung, A. Allgemeiner Teil, Absatz 4).
Ich bitte Sie darum, meine Stellungnahme bei den Beratungen über die geplante Gesetzesänderung zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
...
-
Beamter2007
- Postrank2

- Beiträge: 13
- Registriert: 29.05.2009, 08:38
-
Beamter2007
- Postrank2

- Beiträge: 13
- Registriert: 29.05.2009, 08:38
Die Mail ist angekommen und wurde weitergeleitet. Hier die Zwischenantwort des Bundesausschusses:
Sehr geehrter Herr K., im Auftrag der Vorsitzenden, Abg. Dr. B., danke ich Ihnen für Ihr Email vom 8. Juni 2009, welche ich an die Sprecherinnen und Sprecher (Obleute) der im Ausschuss für Gesundheit vertretenen Fraktionen weitergeleitet habe. Dies gewährleistet, dass Ihre Anregungen und Äußerungen von den Fraktionen aufgegriffen werden und ggf. in parlamentarische Beratungen einfließen können. --
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Sehr geehrter Herr K., im Auftrag der Vorsitzenden, Abg. Dr. B., danke ich Ihnen für Ihr Email vom 8. Juni 2009, welche ich an die Sprecherinnen und Sprecher (Obleute) der im Ausschuss für Gesundheit vertretenen Fraktionen weitergeleitet habe. Dies gewährleistet, dass Ihre Anregungen und Äußerungen von den Fraktionen aufgegriffen werden und ggf. in parlamentarische Beratungen einfließen können. --
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste